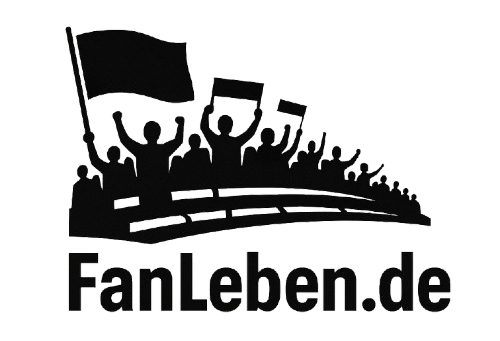Sie holten Neymar für 220 Millionen Euro.
Sie holten Mbappe für 180 Millionen Euro.
Sie machten Ancelotti zum Cheftrainer, Tuchel.
Holten Messi, di Maria, Thiago Silva…
…Und gewannen doch nie mehr als Meisterschaft oder französischen Pokal.
Seit die katarische Sportswashing, pardon, -investment Gesellschaft Quarat Sports Invest 2011 bei Paris St. Germain einstieg, spielte Geld bei PSG keine Rolle. Die Kosten spielten keine Rolle – weder bei Transfers noch bei Gehältern – und die sportliche Strategie war Prestige pur, dabei hätte es sicher klügere und – ja! – sogar sympathischere Wege gegeben. Gehen wir es einmal durch.
Paris St. Germain ist kein Traditionsverein.
Davon gibt es in Paris zwar einige, aber PSG wurde, wie der FC Paris ein Jahr später, 1970 nur gegründet, weil es einen erfolgreichen Hauptstadtklub geben sollte, die Traditionsvereine aber sportlich den Anschluss verloren hatten.
Entsprechend schwer fiel es dem Konstrukt sich in Paris zu verankern. Denn obwohl die französische Hauptstadt eine Millionenmetropole ist und PSG auch vor 2011 längst die erfolgreichste Mannschaft der Stadt stellte, spielte man selten in einem ausverkauften Stadion, die Auslastung lag in den meisten Spielzeiten sogar nur zwischen 60 und 80 Prozent. Und auch in den letzten 15 Jahren seit dem Katar-Einstieg, in denen man sich ja zum Serienmeister entwickelte, betrug die Auslastung in den Ligaspielen nur knapp 98%. Schalke, deren Fans seit Jahre durchgängig von ihrem Verein gefrustet werden, kommt auf 100%. In einem größeren Stadion, in einer kleineren Stadt. In der vergangenen Champions League Saison, in der sich Paris ja sogar erstmals den Titel sichern sollte, lag die Auslastung sogar nur knapp über 90%. Das ist – mit Verlaub – peinlich.
Vor 2011 lag das am ausbleibenden Erfolg. Seit 2011 lag es daran, dass allen klar war, dass es bei PSG eben nicht um Fußball, sondern um Inszenierung geht. Fußball ist ein Prozess – eine Mannschaft, die sich über Jahre entwickelt, eine Fanszene, die sie dabei begleitet, ein Umfeld, dass sich damit identifiziert. Die katarischen Investoren aber setzen über Jahre alles daran, dass eben keine gemeinsame Mentalität entsteht. PSG hat eine der besten Nachwuchsakademien des Landes und machte daraus lange nichts: Christopher Nkunku, Kingsley Coman oder auch Moussa Diaby, um nur einige Beispiele zu nennen, wurden bei PSG ausgebildet, ohne jemals fest zur Profimannschaft zu gehören. Über viele Jahre wurde lediglich Adrien Rabiot ins Team integriert, aber auch er wechselte rasch, nachdem er den Durchbruch erzielt hatte, weil PSG seine Millionen lieber für internationale Stars statt für Eigengewächse ausgeben wollte. Stattdessen verpflichtete man einige große Namen, die aber allesamt weit über ihren Zenit waren (siehe oben).
Klar – internationale Fans wollen lieber die hinzugekauften Superstars sehen als die motivierten Local Player. Aber ohne junge Spieler aus der Region, die eine Mannschaft mit ihrem Umfeld verbinden, sich vielleicht ja sogar mehr mit ihrer sportlichen Aufgabe identifizieren, die dem Team darüber hinaus Struktur und Hierarchie geben und für einen konstruktiven Konkurrenzkampf beziehungsweise im Idealfall sogar für eine beständige Weiterentwicklung sogar, kann ein Klub sein Potenzial niemals ausschöpfen. Paris St. Germain hat das über Jahre bewiesen, Jahre, in denen man mit einem der höchsten Etats in der Champions League doch andauernd viel zu früh ausschied. Das aber enttäuscht am Ende auch die internationalen Fans, von denen sich zwar einige, zu viele sogar, selbst dann noch ein Messi-Trikot kaufen würden, wenn er für den 1. FC Todesstern auflaufen würde, die aber im Zweifel doch lieber das Champions-League-Finale verfolgen als das Meisterschaftsfinale am drittletzten Spieltag der französischen Liga. Über zwei Milliarden Euro investierte Katar in den ersten 10 Jahren in PSG – das Sportwashing-Ziel, mit Paris die Champions League zu gewinnen und konstant zu den besten Teams Europas zu gehören, erreichte man trotzdem nicht.
Und jetzt wird es ironisch. Denn 2025 hat Paris St. Germain dann ja die Champions League gewonnen und steht seit gestern Nacht sogar im Finale der FIFA Klub WM. Wie ist das passiert? Brauchte das Geld also doch nur Zeit, bis es endlich Tore schoss?
Eben nicht. 2023 verpflichtete PSG Luis Enrique als neuen Trainer und änderte Schrittweise die Strategie. Luis Enrique, der 2015 schon einmal mit dem FC Barcelona die Champions League gewonnen hatte, erinnerte sich an das katalanische Erfolgsrezept: Versuchen, die talentierteste Mannschaft der Welt zusammenzustellen und mit ihr schnellen, anspruchsvollen und damit überlegenden Fußball zu spielen. Juan Bernat, Marco Asensio und Milan Skriniar wurden allein im letzten Sommer abgegeben – international bekannte Namen zwar, aber entweder über ihren Zenit (Skriniar) oder aber eher Mitläufer statt Stammspieler in den Mannschaften, denen sie ihren Namen verdanken (Asensio). Stattdessen holte man Désiré Doué, das wohl aufstrebendste Talent im französischen Fußball, João Neves, einen jungen 6er mit genialer Übersicht, und Khvicha Kvaratskhelia vom SSC Neapel, der das Zeug zum internationalen Superstar hat, dessen Trikots sich wie die von Messi von alleine verkaufen, der aber eben noch nicht an seinem Zenit angekommen war und sich unter Enrique genau da hin entwickeln sollte.
Kurzum: Genau dann, als sich die katarischen Investoren von ihrer Strategie verabschiedeten, nach Prestige statt sportlichen System einzukaufen, als sie in diesem Zuge die Investitionskosten senkten und die Kaderkosten in ein angemesseneres Verhältnis zum Rest der französischen Liga stellten, formten sie ihre beste Mannschaft. Die beste Mannschaft, die es gerade im Weltfußball zu bestaunen gibt.
Noch mehr Ironie gefällig? Gerne: Denn mit der Strategie spannende nationale und internationale Talente zu verpflichten und zu entwickeln, passen sich die katarischen Investoren auch wieder der Klub-„Geschichte“ von Paris St. Germain an. Denn Anfang der 2000er Jahre verhalf PSG Spielern wie Spieler wie Nicolas Anelka, Gabriel Heinze oder Ronaldinho zum Durchbruch (in Europa). Es entsteht also fast so etwas wie Konstanz in der Geschichte dieses Fußball-Konstrukts.
Trotzdem haben die Eigentümer von Paris St. Germain mit weit mehr als zwei Milliarden Euro Fußball-fremden Geld den europäischen Markt künstlich aufgebläht. Wie Manchester City haben sie bei Sponsorenverträgen getrickst, eher geschummelt, um nicht gegen das Financial Fair Play zu verstoßen.
Und auch zur kultigen Anekdote taugt die Geschichte nicht. Denn auch wenn es eine schöne Lektion ist, dass tatsächlich Geld allein keine Tore schießt, sondern es ein klares Konzept und ein stimmiges Umfeld braucht, um Potenziale wirklich abzurufen und es ein bisschen fußball-romantisch klingt, dass der Investorenklub gerade dann seinen größten Erfolg feiert, als die Investitionen reduziert werden, ist Paris St. Germain immer noch ein katarisches Kunstprodukt mit dem Ziel Sportwashing zu betreiben. Davon kann auch die sehr gute Jugendarbeit, die clevere Kaderplanung und der Verzicht auf teure Namen nicht ablenken.
Darum: Ende nicht gut, alles nicht gut.