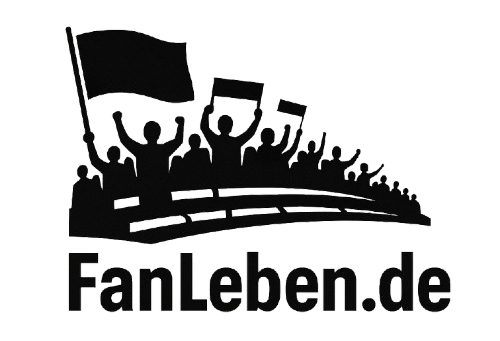Ab der Saison 2027/2028 läuft die Champions League nicht mehr bei DAZN, dafür steigt der US-Anbieter Paramount+ neu ein. Wer bei den Live-Übertragungen für die Champions League und die Fußball-Bundesliga ab 2027 die freie Auswahl haben möchte, benötigt künftig also mehrere Abonnements: Amazon Prime Video und Paramount+ für die Königsklasse, Sky und DAZN für die Bundesliga. Magenta Sport könnte für die dritte Liga, ja nach Präferenz, sogar auch noch dazu kommen.
Nach Medienberichten soll das Finale der Champions League außerdem auch noch bei Netflix laufen – das wäre dann Abo Nummer fünf beziehungsweise sechs. Nur falls ein deutsches Team das Finale erreicht, müsste es in Deutschland dank Rundfunkstaatsvertrag im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt werden. Das günstigste Abo bei Champions-League-Neuling Paramount+ ist derzeit für monatlich 5,99 Euro zu haben, das teuerste kostet 12,99 Euro. Preissteigerungen sind aber mit Blick auf die Königsklasse durchaus zu erwarten. Prime Video ist in der Amazon Prime-Mitgliedschaft enthalten, aktuell liegen die Kosten bei monatlich 8,99 Euro oder jährlich 89,90 Euro. Rabatte gibt es für Studierende und Auszubildende. Bei Sky kostet das Einjahres-Abo für die Bundesliga derzeit 29,99 Euro im Monat und beinhaltet auch die 2. Liga. Nicht enthalten ist aber der DFB-Pokal. Dafür braucht man auch das Sport-Abo für insgesamt 34,99 Euro monatlich. Bei DAZN, wo ab 20207 die Spiele der Europa League und Conference League gezeigt werden, benötigen die Kunden für die Bundesliga-Spiele das Unlimited-Abo. Das kostet beim Streaming-Anbieter 44,99 Euro im Monat oder bei einem Jahresvertrag 34,99 Euro monatlich. Sky und DAZN können aber auch kombiniert gekauft werden, das kostet dann 64,98€ im Monat. Für Magenta Sport zahlt man 9,95€ im Jahres- und 14,95€ im Monatsabo. Und ein monatliches Abo für Netflix kostet aktuell zwischen 4,99 Euro und 19,99 Euro.
FanLeben.de fragt: Wer soll das bitte noch bezahlen?!
Fanproteste werden deswegen laut. Und zwar zurecht laut. In den sozialen Netzwerken macht darum aktuell auch das Foto eines Banners die Runde, das die Fans eines tunesischen Vereins, Club Africain, beim Spiel gegen Paris St. Germain gezeigt haben. Doch: Dieses Foto ist schon älter. Es stammt von einem anderen Protest. FanLeben.de rekonstruiert hier seine beeindruckende Geschichte:

Es geht um ein quer über der Fankurve gespanntes Banner, auf dem „CREATED BY THE POOR, STOLEN BY THE RICH“ – zu Deutsch: Von den Armen geschaffen, von den Reichen gestohlen – stand. Ein Satz, der die Geschichte des Fußballs in wenigen Worten zusammenfasst: geboren im Großbritannien des 19. Jahrhunderts, inmitten der industriellen Arbeiterklasse, später übernommen von Eliteschulen und Universitäten, bevor gemeinsame Regeln dem Sport Struktur gaben. Von dort trat er seinen Siegeszug an – erst national, dann global – und wurde im späten 20. Jahrhundert zum beliebtesten Spiel der Welt. Und dieser Erfolg brachte, spätestens seit den 1990er Jahren, Investitionen in zuvor ungekannter Höhe mit sich. FanLeben.de hat diese Entwicklungen hier einmal dokumentiert.
Aber zurück zur eigentlichen Geschichte. Für den tunesischen Journalisten Firas Kéfi ist das Banner bis heute präsent. Es stammt von Anhänger*innen des Club Africain, die es im Januar 2017 bei einem Freundschaftsspiel gegen Paris Saint-Germain zeigten – jener Verein, der in Paris residiert, aber von Katar kontrolliert wird. Auch dieses Spiel hätte ohne geschäftliche Verbindungen nicht stattgefunden. „Es kam nur dank des gemeinsamen Nenners der Vereine zustande – Ooredoo, dem ersten Mobilfunkbetreiber in Katar, der sich in Staatsbesitz befindet“, erinnert sich Kéfi. „Das Unternehmen sponsert seit 2012 sowohl PSG als auch Club Africain, als sie einen riesigen Vertrag abgeschlossen haben.“
Der Fotojournalist Fethi Belaid, Mitarbeiter der AFP, war damals ebenfalls im Stadion. „Um ehrlich zu sein, hatte ich vergessen, dass ich dieses Foto gemacht hatte“, sagt er. Belaid fotografiert seit Jahren die drei großen Vereine Tunesiens – Club Africain, Espérance Sportive de Tunis und Étoile Sportive du Sahel. Doch sein eigentlicher Schwerpunkt liegt auf den politischen Entwicklungen seines Landes: von den Protesten 2011, die zum Sturz Ben Alis und zum Arabischen Frühling führten, bis zu den jüngsten Auseinandersetzungen im Januar 2021 zwischen Polizei und Demonstranten, die gegen die anhaltende wirtschaftliche Misere aufbegehrten. „Die Arbeit bei einem Fußballspiel scheint viel einfacher zu sein, aber man muss den Kontext dahinter erkennen können“, sagt Belaid rückblickend. Das Banner sei für ihn „eine perfekte Momentaufnahme der Beziehung zwischen den Fans des Club Africain und der damaligen Vereinsführung„.
Ein Blick in die Geschichte: Der Club Africain entstand 1919 unter französischer Kolonialherrschaft. Aus Angst, der Verein könne antikoloniale Bestrebungen fördern, erkannten die Behörden ihn erst 1920 offiziell an. Traditionell wurde der Club Africain von der tunesischen Arbeiterklasse getragen. 1947 gewann er seinen ersten Meistertitel, und zwischen den 1960er und 1980er Jahren folgten nationale wie internationale Erfolge. Danach wurde es ruhiger um den Verein, der seither nur noch sporadisch Titel holte. Gleichzeitig traten nach der Revolution von 2011 neue politische Akteure auf den Plan, entschlossen, das entstandene Machtvakuum zu nutzen.
„Als Slim Riahi Vorsitzender des Vereins wurde, kannte ihn in Tunesien niemand“, sagt Kéfi. „Wir wussten nur, dass er sein Vermögen im libyschen Ölsektor vor dem Sturz Gaddafis gemacht hatte.“ Riahi, in den 1970er Jahren in Tunesien geboren und in Libyen aufgewachsen, kehrte 2011 mit politischen Ambitionen in sein Heimatland zurück und gründete die Freie Patriotische Union, eine neoliberale, anti-islamistische Partei. „Er holte einen der besten algerischen Spieler der damaligen Zeit, Abdelmoumene Djabou, für eine Rekordsumme“, erzählt Kéfi. Für einen Klub, der traditionell auf Spieler aus dem eigenen Nachwuchs setzt, war das ein drastischer Schritt – mit zunächst durchaus sportlichem Erfolg. Gestützt auf seine wachsende Popularität schaffte es Riahi, bei den Parlamentswahlen 2014 sechzehn Sitze für seine Partei zu gewinnen.
Kéfi, der ebenfalls beim Spiel gegen PSG anwesend war, erklärt, die Botschaft des Banners habe sich sowohl an Riahi als auch an den PSG-Präsidenten Nasser al-Khelaïfi gerichtet. „Die Curva Nord ist einigen verschiedenen Fanclubs vorbehalten – den Winners, den Leaders, den Dodgers und den Vandals“, sagt er. „Auch wenn sie nicht politisch sind, stehen die Vandals den finanziellen Interessen im modernen Fußball zutiefst feindselig gegenüber. Und diese Art von Spiel war die perfekte Bühne, um ihre Ideen zu verbreiten.“ Sheva, ein aktiver Club-Africain-Fan auf Twitter, bestätigt das: „Für uns war es eine gute Gelegenheit, laut zu verkünden, dass es bei diesem Sport um Begeisterung, Leidenschaft, Wettbewerb und Spannung geht – nicht um Geld“, sagt er.
Während der Revolution spielten die tunesischen Ultras ohnehin eine besondere Rolle: Sie wurden zu einem wichtigen Teil des Widerstands, standen häufig an vorderster Front gegen die Polizei. „Der Club Africain hat dafür einen hohen Preis bezahlt„, sagt Belaid.
Bis 2017 hatte sich Riahi in zahlreiche Skandale verstrickt. Wenige Monate nach dem Spiel wurden seine Vermögenswerte wegen des Verdachts auf Geldwäsche eingefroren. Im Sommer desselben Jahres verließ er den Club Africain und ging ins selbst gewählte Exil in die Emirate – nicht ohne dem Verein einen Berg an Schulden zu hinterlassen. Überlebt hat der Club Africain diese Phase nur dank seiner Fans, die zwischen 2,5 und 3 Millionen Euro sammelten. „Eine unglaubliche Summe angesichts der sozioökonomischen Verhältnisse in Tunesien“, sagt Kéfi.
Doch trotz dieser beeindruckenden Solidarität blickt Belaid weder für seinen Verein noch für sein Land optimistisch in die Zukunft. „Das tunesische Volk hat die Revolution begonnen, weil es arm war. Zehn Jahre später ist es das immer noch“, sagt er. „Die Situation des Club Africain spiegelt die des Landes wider. Wir scheinen einfach nicht darüber hinwegzukommen.“
Im Gegenteil: Manchmal scheint alles nur noch schlimmer zu werden.