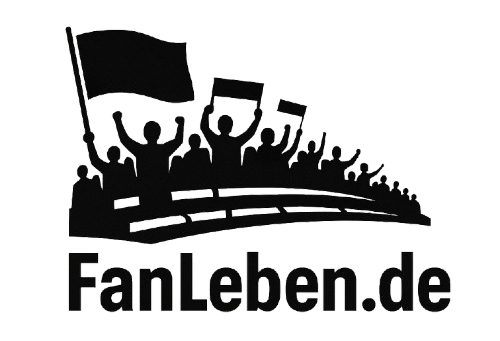Seit Februar wird im Stadion am Millerntor die Hymne „Herz von St. Pauli“ aus dem Jahr 1956 nicht mehr gespielt, weil Hinweise auftauchten, ihr Texter Joseph Ollig könnte an NS-Propaganda beteiligt gewesen sein. Im Umfeld des „FC St. Pauli-Museums“ suchten daraufhin auch Fans nach Spuren – mit ernüchterndem Ergebnis. Daraufhin einigten sich Fans und Verein darauf, eine Studie in Auftrag zu geben, die die historische Bedeutung von Joseph Ollig aufarbeiten sollte.
Celina Albertz, die Leiterin des Museums, verfasste die Studie und beschreibt Ollig so: „Aus den Quellen lässt sich das Bild eines angepassten und ehrgeizigen Journalisten zeichnen, der sich gut in verschiedene politische Systeme einfügen konnte. Nach dem Krieg begann Ollig parallel zu seiner Berufslaufbahn als Ressortleiter Liedertexte zu schreiben. Ansonsten zeigte seine Karriere aber wenig Brüche.“ Begonnen hat seine Karriere in Hamburg. Der gebürtige Kölner Ollig zog nämlich als Journalist in die Hansestadt, um für eine rechtsradikale Tageszeitung, die „Hamburger Nachrichten“, zu arbeiten, wie Albertz erklärt: „Die Zeitung bezeichnete sich zwar als »national-parteilos«, war aber alles andere als neutral. Vielmehr förderte sie das gesamte rechtsextreme Spektrum schon vor der Diktatur und war extrem republikfeindlich. Mit den Wahlerfolgen der NSDAP 1930 begann sie offen und aktiv die Nationalsozialisten zu unterstützen. Es gab sogar eine interne Abstimmung in der Redaktion, die diese Linie bestätigte.“ Und weiter: „Der politische Charakter der Zeitungen war damals allgemein bekannt und Bewerber identifizierten sich in der Regel mit der Ausrichtung ihres Arbeitgebers. Zeitungen waren das wichtigste Leitmedium in der Weimarer Republik und stark polarisiert. Ollig wusste also, worauf er sich einließ.“ Und er hätte Alternativen gehabt, denn – anders als heute – war der Zeitungsmarkt in den 1920er und 1930er Jahren ziemlich breit aufgestellt. Dennoch ist die konkreten Texte, die Ollig für die spätere Nazi-Zeitung schreib, heute auch Studien-Macherin Albertz wenig bekannt: „Wir hatten bei der Untersuchung das Problem, dass in den Dreißigerjahren keine Namen oder Autorenkürzel unter den meisten Texten standen. Konkrete Artikel von Ollig haben wir deshalb erst für die Jahre danach in den Archiven gefunden. Die grundsätzliche Ausrichtung der ‚Hamburger Nachrichten‘ war aber eindeutig. Es wurde mit bildungsbürgerlichem Duktus Hitler gefeiert und gegen Kommunisten, Sozialdemokraten und Juden gehetzt. Und Ollig war eben Teil des Politik-Ressorts der Zeitung.“
Neben Celina Albertz arbeitete Peter Römer an der Studie mit. Der 41-jährige ist Historiker und Politikwissenschaftler, der als stellvertretender Leiter des Geschichtsorts Villa ten Hompel in Münster tätig ist. Er befasste sich dabei vor allem mit Olligs weiteren Lebensweg. Denn 1933 verließ Ollig die Zeitung und wechselte zur Werkszeitung von Shell. Warum? „Der Wechsel war keine Flucht ins Unpolitische. Die Firma hatte Verbindungen zur Parteiführung und ihr Vorstandsvorsitzender, Henri Deterding, gehörte schon seit den Zwanzigerjahren zu den wichtigsten Finanziers der NSDAP. Er spendete der Partei Millionen. Ollig machte bei der Werkzeitschrift Karriere und übernahm ab 1936 redaktionelle Mitverantwortung, Ende der Dreißigerjahre wurde er sogar Hauptschriftleiter – eine Art Chefredakteur. Unter seiner Leitung wurde die Werkszeitung immer stärker zu einem NS-Propagandaorgan.“ Dabei war die Reglementierung bei den Werkszeitungen deutlich geringer als in der klassischen Presse. Es gab etwa keine Verpflichtung, tagespolitische Themen aufzugreifen. Ollig hätte bei Shell also niemals für Hitler werben müssen, er tat es aus Überzeugung. Historiker Römer nennt dafür ein weiteres konkretes Beispiel: „Im Jahr 1939 haben wir einen Artikel unter Olligs Kürzel gefunden, der sich um das gescheiterte Attentat drehte, das der schwäbische Schreiner Georg Elser auf Hitler mit einer selbst gebastelten Bombe verübte. Elser wird darin als ‚Meuchelmörder‘ dargestellt und Hitler als mystischer und ‚von der Vorsehung geschützter Führer‘ beschrieben.“
Während des zweiten Weltkrieges war ab September 1941 als Kriegsberichter für eine Propagandakompanie tätig. Er war damit kein gewöhnlicher Soldat, auch wenn er sich an mehreren Feldzügen beteiligte und dabei auch verwundet wurde. Celina Albertz erklärt: „Er verfasste Artikel von der Front, in denen er seine vermeintlichen Eindrücke vom Kriegsgeschehen festhielt, die in der Heimat den Durchhaltewillen befeuern und den Feind entmenschlichen sollten.“ Wie es nach dem Krieg für Ollig weiterging, fasst Peter Römer so zusammen: „Die Prüfungen (in Entnazifizierungsprozessen, Anm. d. Red.) wurden nachlässig betrieben. So wurde Ollig zwar als belastet eingestuft und es wurde auch empfohlen, ihn nicht weiter als Journalisten einzusetzen, aber nicht in seinem eigentlichen Entnazifizierungsausschuss für Journalismus. Sondern in dem für die Erdölindustrie. Hierbei wurde auch vermerkt, dass er »definitiv untragbar« für eine demokratisch orientierte Presselandschaft sei. Am Ende passiert aber nichts, und Ollig konnte kurz nach dem Krieg bereits Teil der Gründungsredaktion der Tageszeitung ‚Welt‘ werden. Später schaffte er es bis in die Chefredaktion des ‚Hamburger Abendblattes‘ und verbrachte dort viele weitere Jahre.“ Wahrscheinlich ab 1951 begann zu zudem damit Schlager wie „Das Herz von St. Pauli“ zu schreiben.
Die Studie ist in ihrem Ergebnis also eindeutig. Ollig war kein Mitläufer – sondern Täter. Aus dem vorüberrgehenden Aussetzen seiner Hymne wurde darum zur neuen Saison die dauerhafte Entscheidung, das Lied nicht mehr zu spielen. „Wir wissen und verstehen absolut, dass das Lied für viele Menschen eine sehr große emotionale Bedeutung hat“, betont Präsident Oke Göttlich. Das könne auf persönlicher Ebene auch so bleiben, doch eine Hymne im Stadion solle die Menschen zusammenbringen und verbinden. Das sei aber aktuell nicht möglich, denn viele Mitglieder und Fans hätten deutlich gemacht, dass sie sich mit dem Lied nicht mehr wohl fühlen. Göttlich: „Wir verstehen und respektieren die verschiedenen Argumente in dieser komplexen Diskussion.“ Die Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit ist beim FC St. Pauli dabei keineswegs nicht neu. So sorgte in den 1990er-Jahren etwa der Stadionname für hitzige Debatten. Die Arena trug zu Ehren des früheren Vereinspräsidenten jahrelang den Namen „Wilhelm-Koch-Stadion“. Als dessen Vergangenheit als NSDAP-Mitglied aufgedeckt wurde, traf die Mitgliederversammlung des Vereins eine klare Entscheidung: 1998 wurde das Stadion umbenannt und heißt seitdem Millerntor-Stadion. Anders als Göttlich heute hatten sich damals jedoch noch Pauli-Verantwortliche gegen diese Konsequenz ausgesprochen und auf Kochs Lebensleistung vor und nach dem Hitler-Regime verwiesen. Damit waren sie in der Minderheit – und lagen falsch. „Veränderungen schaffen Raum für Neues“, findet heute auch Göttlich. Das betreffe auch die Lieder, die im Stadion gespielt würden.
Apropos: Eine neue Hymne hat sich der FC St. Pauli mit der Entscheidung aber noch nicht gegeben. Stattdessen laufen wechselnde Lieder vor den Spielen. „Wir werden genau hinhören, welche Songs besonders gut funktionieren, welche angestimmt und mitgetragen werden. Möglicherweise entsteht auf diesem Weg Schritt für Schritt ein gemeinsamer Favorit, der sich wie von selbst zu einer neuen Hymne entwickelt“, heißt es in einer Vereinsmitteilung. Und weiter: Unter anderem haben „wir uns für Diamonds von Rihanna entschieden. Ein Lied, das nicht der klassischen Vorstellung einer Hymne entspricht, wie wahrscheinlich einige Songs, die wir im Laufe der Saison spielen werden. Diamonds wird seit Jahren in der Fanszene gerne angestimmt und wir haben im Stadion gesehen und gehört, wie viele Leute lauthals mitgesungen haben.“
Denn Fakt ist: Musik gehört zu St. Pauli. Der Stadtteil steht für Club- und Subkultur, für Vielfalt und kreative Energie. Der Verein schreibt: „Wir wollen diese Vielfalt nicht einschränken, sondern bewusst fördern und abbilden. Eine Hymne lässt sich nicht verordnen. Sie wächst, wenn sie von vielen getragen wird. Genau das wollen wir zulassen und gemeinsam ausprobieren.“ Ziemlich cool, eigentlich.